

Die Versorgung mit dem wichtigsten Lebensmittel Wasser setzt einen intakten Wasserkreislauf im Naturhaushalt voraus. Darum ist es wichtig, die komplexen Zusammenhänge zwischen
Natur- und Umweltschutz, dem Gewässerschutz und der Trinkwasserversorgung zu kennen.
„Grundwasser, Ökosysteme und Menschen profitieren auch wechselseitig vom jeweiligen Wohlergehen. Das gemeinsame Wohlergehen kann durch Grundwasserbewirtschaftung, kombinierte Wasser- und
Landbewirtschaftung, naturnahe Lösungen und verbesserten Schutz von Ökosystemen gestärkt werden.
Während sich die Grundwasserbewirtschaftung häufig auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserleiter selbst konzentriert, müssen Grundwasser und Ökosysteme gemeinsam bewirtschaftet werden, damit wichtige Ökosystemleistungen kontinuierlich und verlässlich bereitgestellt werden können.“ (Weltwasserbericht 2022, Zusammenfassung; S. 5f).
Böden nehmen hier eine Schlüsselstellung ein. Ich schreibe mit Absicht „Böden“, denn Böden sind kein gleichförmiges Substrat, wie Blumentopferde aus dem Sack, sondern je nach Lage, Alter,
Ursprungsgestein, Klima, Feuchtigkeit usw. unterscheiden sich Böden in ihrem Aufbau und physikalisch-chemischen Eigenschaften. Aber entscheidend für die Entwicklung sind immer die Pflanzen,
Tiere, Pilze und Mikroben, die auf und in dem Boden seit alters her existieren. Sie machen den Boden und der jeweilige Boden wiederum ist Basis für ein bestimmtes Ökosystem.
Nur ein intakter, „gesunder“ Boden kann die Leistungen erbringen, die für unser Wohlergehen unverzichtbar sind. „Gesund“ ist ein lebendiger Boden. „Eine hohe Diversität der
Organismengemeinschaften in Böden ist die Grundlage für deren Multifunktionalität und Resilienz.“ (Faktencheck Artenvielfalt; S. 918) Böden sind die artenreichsten Lebensräume unserer
Erde. Sie sind von unschätzbarem Wert – und überlebenswichtig.
Im Boden werden Nährstoffe ab- und umgebaut, sodass sie pflanzenverfügbar bleiben und nicht verloren gehen. In der Natur gibt es keinen Müll. Alles findet im Boden einen Abnehmer und wird am Ende
perfekt recycelt. Das Beziehungsnetz der Bodenlebewesen macht es möglich, dass menschengemachte chemische Substanzen bis zu einem gewissen Grad unschädlich gemacht werden können. Aber die
Kapazitäten sind endlich.
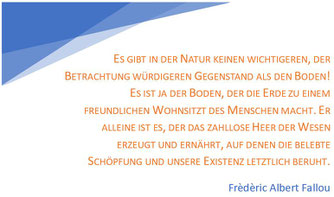
Nicht nur für Stoffkreisläufe sind Böden unentbehrlich, sondern auch für den Wasserkreislauf. Intakte Böden können Starkregenereignisse abfedern, indem sie einen großen Teil des
Regens wie ein Schwamm aufnehmen und in Trockenperioden langsam wieder an die Pflanzen abgeben. Böden können also Wasser entgegen der Schwerkraft festhalten. Versickert mehr Wasser, als der Boden
speichern kann, sickert es ins Grundwasser. Auf dem Weg reagiert es nicht nur mit dem Gestein und puffert so für eine Weile Schadstoffe im Wasser ab, sondern ist auch in biochemische Abläufe
involviert. Am Ende des Prozesses liefert der Boden sauberes Trinkwasser.
Gesunde Böden speichern aber auch das Klimagas Kohlendioxid (CO2) – mehr als es Wälder tun. Maßgeblich ist der Humus in den obersten 30 cm des Bodens. Er besteht aus organischem Material.
Nachhaltige Bodenbewirtschaftung kann CO2 aus der Atmosphäre binden. Das ist gut für das Klima und die Biodiversität. Denn: „Wer hat´s erfunden?“ Der Regenwurm und seine Freunde.
Damit ist das Thema für das Jahr 2025 gefunden: „Der Boden lebt. - Es lebe der Boden!“
