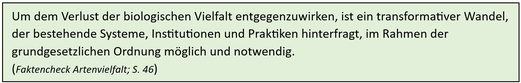Deutschland kann auf eine lange Naturschutztradition zurückblicken. 1976 traten fortschrittliche Naturschutzgesetze in Kraft, die Belange des Diversitätsschutzes im
Planungsrecht beachteten. Man verpflichtete sich auf globaler Ebene und formulierte 2007 eine nationale Biodiversitätsstrategie (NBS) sowie ein entsprechendes Bundesprogramm für
Biologische Vielfalt (BMUB 2007).
Aber: „Die Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und Instrumentarium einerseits und ökologischer und gesellschaftlicher Realität andererseits ist offensichtlich.“ (Faktencheck Artenvielfalt,
2024; S. 118)

Für den Faktencheck Artenvielfalt hat eine Vielzahl von Wissenschaftlern die verfügbaren Daten ausgewertet. Die Ergebnisse sind alarmierend. Über die Hälfte der Lebensraumtypen Deutschlands sind in einem ungünstigen Zustand. Bei den terrestrischen und aquatischen Lebensräumen der Binnengewässer und Auen sind es sogar 70%. Als besonders schlecht wird der Zustand der Binnengewässer und Feuchtgebiete eingeschätzt, insbesondere der Niedermoore, Sümpfe und Quellen.
Für die Binnengewässer ergab ein Vergleich der Rohdaten aus Zeitreihen seit ca. 1950 folgendes Bild: Bei den Gemeinschaften der Wirbellosen überwogen die negativen Trends, eine Entwicklung, die in den 1970/80er Jahren ihren Tiefpunkt erreichte, sich seit den 1990er Jahren aber verbesserte. Die Anstrengungen bei der Errichtung von Kläranlagen zeigten Ergebnisse. Dieser positive Trend kam aber 2010 zum Erliegen. Die Erholung war auch nicht universell und blieb vor allem stromabwärts von Staudämmen, städtischen Gebieten und Ackerland aus. Bei all diesen Analysen ist zu berücksichtigen, dass die Datenlage es meist nicht erlaubt, als Basis für die Änderungen den Zeitraum vor 1950 zu wählen, und dass große Verlust bereits vorher zu verzeichnen waren.

Große Hoffnungen für den Artenschutz in Gewässern löste die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; 2000) aus. Sie verlangt einen guten ökologischen und chemischen Zustand der Flüsse,
Seen und Meere bis spätestens 2027. Leider steckt sie bei genauer Betrachtung voller Ausnahmen und in Deutschland werden sie alle ausgenutzt bis sie zur allgemeinen Regel verkommen.
Daneben gibt es Einschränkungen bei der Datenerfassung, die die Bemühungen schon konterkarieren können. Die WRRL verlangt eine regelmäßige Erfassung des biologischen Inventars der Gewässer. Die
Berichterstattung umfasst aber nur Fließgewässer mit Einzugsgebieten größer als 10 km² und Seen mit einer Fläche größer als 0,5 km², sodass die zahlenmäßig weit bedeutsameren kleineren
Oberflächengewässer (Quellen, Quellbäche, kleinere Seen, Tümpel, Weiher) nicht berücksichtigt werden, obwohl sie für die biologische Vielfalt eine große Rolle spielen. Aber auch für die
überwachten Flüsse und Bäche sind die Daten erschreckend: mit Stand 2021 verfehlen rund 92% von ihnen den guten ökologischen Zustand.

Der chemische Zustand sieht auch nicht besser aus. Die WRRL schreibt die Überwachung und Eliminierung von zahlreichen schädlichen Stoffen aus Industrie und Verkehr vor. In Deutschland
überschreiten Gifte wie Blei überall die Grenzwerte, so dass die Ampeln landesweit auf Rot stehen. Man malt daher lieber Karten, die die „ubiquitären Stoffe“ weglassen und nur Nährstoffe wie
Nitrat aufzeigen. Auf den ersten Blick sieht die Welt dann grüner aus, aber die unzähligen Staue und Kleinkraftwerke sorgen für Strukturen, die der Vielfalt im Gewässer den Rest geben.
Stellt sich die Frage, warum hat sich in den 20 Jahren, in denen die WRRL wirken sollte, so wenig geändert? Die Antwort lautet: ihre Ziele konkurrieren mit den wirkmächtigen
Ansprüchen anderer Bereiche, wie Landwirtschaft und Energie. Die WRRL ist nur behördenintern verpflichtend und setzt bei der Umsetzung allein auf Freiwilligkeit. Die Verfahren
für Maßnahmen sind langwierig und die zuständigen Behörden unterbesetzt. Keine guten Vorzeichen.

Was ist notwendig, um den Trend umzukehren?
Nichts Geringeres als ein gesamtgesellschaftlicher Perspektivwechsel. Da sind die Politiker und Behörden genauso gefragt, wie Wirtschaft und jeder Einzelne. Damit Schutz und
Mehrung der biologischen Vielfalt einen höheren Stellenwert bei Abwägungsprozessen erhalten, müssen die sozialen und ökologischen Folgekosten in die Berechnungen einfließen. Das gilt auch für das
Klimaproblem! Vielleicht sollten beide als Staatsziele in das Grundgesetzt aufgenommen werden.
Bis das gelingt, ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber Wissensvermittlung allein reicht nicht, um ein Umdenken zu generieren. Es braucht eine tragfähige Vision, ein Bild von einer
Landschaft, die sowohl dem Wirtschaften des Menschen als auch der Vielfalt an Leben eine Bühne bietet.
Die Wissenschaftler des Faktencheck Artenvielfalt haben auch einige Maßnahmen ausgemacht, die grundsätzlich helfen würden. Priorität, nach ihrer Einschätzung, erhält die Minimierung des
Nährstoffeintrags in der Fläche, speziell Stickstoff und Phosphat. Dies würde den Erhalt von nährstoffarmen Lebensräumen in Wald und Flur und deren lebendiges Inventar ermöglichen. So könnte auf
jeden Fall der Druck von den Gewässern genommen und die Voraussetzung für den langfristigen Schutz des Trinkwassers geschaffen werden.